199 |
Institutionen im politischen System
Hartmut Wasser
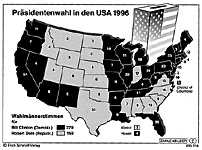
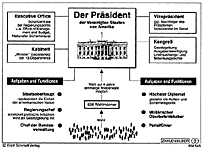
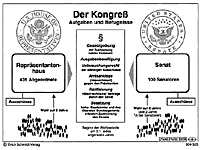

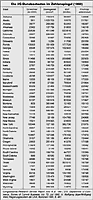
Der Verfassung, der Flagge und der Präsidentschaft hat stets die Verehrung der Amerikaner gegolten, die in diesen drei Elementen wichtige Integrationsfaktoren ihrer so heterogenen Gesellschaft erblick(t)en. Vietnam und Watergate, die äußere und innere Verstrickung des Landes in machiavellistische Machtpraktiken während der sechziger und siebziger Jahre, rief bei vielen Amerikanern heftige Kritik hervor. Diese richtete sich jedoch mehr gegen die jeweiligen Inhaber der höchsten Ämter als gegen die Institutionen selbst. Das Vertrauen in die Integrität der Präsidenten Lyndon Johnson und Richard Nixon oder die Amtskompetenz Jimmy Carters wie Ronald Reagans sank, ohne daß das Weiße Haus als überkommene Herrschaftseinrichtung öffentlicher Mißachtung ausgesetzt worden wäre.
Amerikaner verweisen gerne auf Traditionen und Kontinuitäten in ihrer verfassungspolitischen Entwicklung. Was die Präsidentschaft anbelangt, so läßt sich die Kraft der Überlieferung am Text der US-Verfassung dokumentieren, der sich hinsichtlich der Aufgaben und Beschränkungen der Exekutive wie ihres Bestellungsverfahrens seit zweihundert Jahren nicht oder nur unwesentlich verändert hat. Dennoch würden George Washington, John Adams oder Thomas Jefferson das Amt, das sie in der Frühzeit der Republik mit politischem Leben erfüllt haben, heute kaum noch erkennen: Ungeschriebenes Verfassungsrecht, die Macht der Gewohnheit, Urteilssprüche der Obersten Richter, gesetzliche Vorschriften und die Dynamik der Geschichte haben den Wandel des Amtes bewirkt und sanktioniert.
Präsidentenamt
Wesentliche Unterschiede fallen schon bei Auslese und Wahl der Kandidaten für das höchste Amt ins Auge, wenn man die Prozeduren am Ausgang des 18. Jahrhunderts mit heutigen Gepflogenheiten vergleicht. Geblieben ist nur die Beschränkung der Amtsperiode auf vier Jahre und der von George Washington ins Leben gerufene Leitsatz, kein Bürger des Landes solle länger als höchstens acht Jahre an der Spitze des Staates stehen. Im XXII. Verfassungszusatz (Amendment) von 1951 wurde der Grundsatz der Einmaligkeit der Wiederwahl definitiv festgeschrieben, nachdem Franklin Delano Roosevelt wegen des Zweiten Weltkrieges insgesamt drei Amtszeiten im Weißen Haus verbracht (und damit zum erstenmal das "ungeschriebene Verfassungsrecht" durchlöchert) hatte.
Der Präsident wird durch Wahlmänner (electors) gewählt. In jedem Staat werden so viele Wahlmänner gewählt, wie der Staat Vertreter in den Kongreß entsendet, mindestens also drei (zwei Senatoren und mindestens einen Repräsentanten). Zusammen sind es 538 Wahlmänner, 100 (für die Senatoren), 435 (für die Mitglieder des Repräsentantenhauses) und drei Wahlmänner für den District of Columbia, die Hauptstadt Washington, die nicht im Kongreß vertreten ist, sondern als bundeseigener Bezirk der Jurisdiktion des Kongresses unterworfen ist.
Sämtliche Wahlmännerstimmen eines Staates werden für den Präsidentschaftskandidaten abgegeben, der die Mehrheit der Stimmen in diesem Staat erhalten hat. Für jeden Kandidaten ist es wichtig, diejenigen Staaten zu "erobern", die viele Abgeordnete in das Repräsentantenhaus entsenden und damit viele Wahlmänner stellen, so Kalifornien mit 54, Texas mit 32, New York mit 33 oder Illinois mit 22. Die Zahlen ändern sich alle zehn Jahre, wenn durch eine nationale Bevölkerungserhebung Veränderungen in der Einwohnerzahl der Einzelstaaten festgestellt worden sind.
Die Verfassungsväter begründeten im Federalist den politischen Hintergrund der komplizierten Prozedur: Die Wahl des obersten Beamten direkt dem Volk zu überlassen, sei ebenso sinnvoll, als wenn man einen Blinden mit der Auswahl von Farben beauftrage. Ganz sicher aber sei das Volk in der Lage, erfahrene und umsichtige Männer im überschaubaren Bereich der Einzelstaaten mit dem Auftrag auszustatten, in freier Gewissensentscheidung das Oberhaupt des Staates auszuwählen.
Die fortschreitende Demokratisierung des politischen Prozesses in den USA hat im Verbund mit dem sich organisierenden Parteiwesen den Charakter der Präsidentschaftswahl entscheidend verändert: Heute präsentieren Parteien in den Einzelstaaten Wahlmännerlisten. Die Wahlmänner tragen ein Parteietikett, werden als Republikaner oder Demokraten vom Volk gewählt und sind faktisch verpflichtet, den vom Nationalkonvent gekürten Präsidentschaftskandidaten ihrer Partei zu bestätigen. Einige Einzelstaaten haben diese Regel inzwischen auch im Verfassungsrecht festgeschrieben, um jede Abweichung von dieser ungeschriebenen Verpflichtung zu verhindern.
Auch der Ausleseprozeß der Kandidaten für das Weiße Haus hat sich gewandelt. Ursprünglich wurden die Präsidentschaftskandidaten von den Kongreßfraktionen nominiert. Später ging dieses Recht auf die Delegiertenkonferenzen (conventions) der Parteiorganisationen über. Es erwies sich jedoch, daß sowohl die Auswahl der Delegierten für die conventions wie auch die der Kandidaten für das Präsidentenamt von kleinen Gruppen einflußreicher Parteibosse manipuliert und oft hinter verschlossenen Türen vorgenommen wurde. Verschiedene Einzelstaaten führten um die Jahrhundertwende Vorwahlen (primaries) ein, um das Wahlverfahren zu demokratisieren. In den 90er Jahren bedient sich die Mehrheit der amerikanischen Bundesstaaten (durchschnittlich etwa 38 von ihnen) dieses Verfahrens. Es gibt verschiedene Arten von Vorwahlen:
- Geschlossene Vorwahlen (closed primaries) - an denen nur jene Wählerinnen und Wähler mitwirken dürfen, die sich offiziell als Mitglieder einer Partei haben registrieren lassen.
- Offene Vorwahlen, an denen sich alle Wahlberechtigten beteiligen können.
Parallel zu den Vorwahlen finden in einer Reihe von Staaten sogenannte Präferenzwahlen (presidential primaries) statt, die den Wählern die Möglichkeit geben, die Auswahl der Präsidentschaftskandidaten ihrer Partei direkt zu beeinflussen, gegebenenfalls sogar neue Bewerber ins Spiel zu bringen. Die Konsequenzen der Vorwahlen unterscheiden sich in den einzelnen Staaten. In manchen sind die gewählten Parteitagsdelegierten verpflichtet, dem Sieger der presidential primary ihres Staates auf dem Nationalkonvent für einen oder mehrere Wahlgänge ihre Stimme zu geben. In anderen ist die Vorwahl nicht mehr als eine Art Meinungsumfrage ohne Wahlbindung für die Delegierten.
Ursprünglich sollten die Vorwahlen die endgültige Nominierung der Präsidentschaftskandidaten nicht vorbestimmen, vielmehr als eine Art Stimmungsbarometer fungieren, das anzuzeigen hatte, welcher Kandidat die besten Chancen besäße, zum Präsidenten der USA gewählt zu werden. Die eigentliche Entscheidung fällt nach wie vor auf den demokratischen und republikanischen Parteikonventen. Dieses Prinzip ist freilich in den letzten Jahrzehnten immer wieder durchbrochen worden. In dem Maße, wie sich die Zahl der Vorwahlstaaten vergrößerte, das Bürgerinteresse an den primaries zunahm und die modernen Massenmedien jede Vorwahl zum nationalen Spektakel ausweiteten, ist ein Kandidatensog entstanden, dem sich die Nationalkonvente nicht mehr entziehen konnten. Ehe die Parteitage im Sommer eines Präsidentschaftswahljahres zusammentreten, haben sich eindeutige "Spitzenreiter" im nationalen Bewußtsein etabliert, sind nicht selten sogar werbewirksame "Außenseiter" (Jimmy Carter 1976) von den Medien ins Rampenlicht der Öffentlichkeit gerückt und damit Fakten gesetzt worden, die von den Nationalkonventen "geschluckt" werden müssen, wenn sie die Siegchancen ihrer jeweiligen Partei nicht drastisch beschneiden wollen.
Wenn sich im Lauf der Zeit die indirekte Wahl des Präsidenten zur faktischen Volkswahl fortentwickelte, so hat dieser Prozeß doch entgegen den Befürchtungen der Verfassungsväter keine Demagogen ins höchste Amt der USA befördert. Die politische Tradition des Landes, die Vielfalt der regionalen Gliederungen und ethnischen Gruppierungen haben ebenso wie der weltanschauliche und soziale Pluralismus in den USA eher den vermittelnden, ausgleichenden, freilich auch oft genug den mittelmäßigen Kandidaten begünstigt.
Neben der von der "elektronischen Demokratie" unserer Zeit geforderten "Telegenität" muß ein Bewerber um die Präsidentschaft ein gerütteltes Maß an Standfestigkeit mitbringen, um das lange Hürdenrennen zum Weißen Haus bestehen zu können. Und obwohl seit den frühen siebziger Jahren die staatliche Finanzierung bei Präsidentschaftswahlen eingeführt worden ist, verlangt die Wahlkampagne doch noch immer beträchtliche Eigenmittel des Bewerbers, die er entweder aus eigenem Vermögen oder über Spenden bezieht.
Auszüge aus den Federalist Papers 1787/88
Die ”Federalist Papers”, eine 1787/88 in verschiedenen New Yorker Zeitungen erschienene Sammlung von Aufsätzen, von Alexander Hamilton, James Madison und John Jay unter dem gemeinsamen Pseudonym ”Publius” verfaßt, interpretierten und verteidigten die neue Verfassung des Konvents von Philadelphia, um ihre Ratifikation durch den Staat New York zu sichern. Diese Aufsätze erschienen schon Ende 1788 gesammelt in zwei Bänden: Gültiger Ausdruck der ”politischen Kultur” des Landes und klassisches Werk der politisch-philosophischen Literatur.
Der Gedanke der Repräsentation
Die Behauptung, daß sich die republikanische Regierungsform auf ein verhältnismäßig kleines Gebiet beschränken müsse, wurde bereits in den vorhergehenden Artikeln untersucht und als unbegründet zurückgewiesen. Ich bemerke hier bloß, daß dieser Irrtum seine Entstehung und Verbreitung hauptsächlich der Verwechslung einer Republik mit einer Demokratie zu verdanken scheint, wobei die Argumente, die für die letztere Staatsform zutreffen, auf die erstere angewendet wurden. Auf den Unterschied zwischen den beiden Staatsformen wurde ebenfalls bereits bei einer früheren Gelegenheit hingewiesen. Er besteht darin, daß in einer Demokratie das Volk selbst zusammentritt und in eigener Person die Regierung ausübt, während in einer Republik die Vertreter des Volkes zusammentreten und an seiner Stelle die Regierung ausüben. […]
Ein solcher Irrtum mag um so weniger durchschaut worden sein, als die meisten Volksregierungen der Antike dem demokratischen Typus angehörten, und sich selbst im modernen Europa, dem wir das wichtige Prinzip der Volksvertretung verdanken, kein Beispiel einer echten uneingeschränkten Volksregierung findet, die gleichzeitig uneingeschränkt auf jenem Prinzip beruhen würde. Wenn Europa das Verdienst für sich in Anspruch nehmen kann, diesen wichtigen Mechanismus der Regierung erfunden zu haben, mit dessen Hilfe der Wille einer noch so großen politischen Körperschaft auf jedes Ziel gerichtet werden kann, welches das allgemeine Wohl erfordert, so gebührt Amerika das Verdienst, die Grundlage für die Einrichtung echter und ausgedehnter Republiken entdeckt zu haben […]
Artikel 14 (James Madison)
Checks and Balances.
Zu den Haupteinwänden, welche die achtenswerten Gegner der Verfassung vorbringen, gehört die ihr angelastete Verletzung jenes politischen Grundsatzes, der besagt, daß die gesetzgebende, die vollziehende und die richterliche Gewalt deutlich voneinander getrennt sein müssen. Es wird behauptet, daß diese für die Freiheit wesentliche Vorsichtsmaßregel beim Aufbau der Zentralregierung nicht berücksichtigt worden sei. Die verschiedenen Machtbefugnisse seien in einer Weise verteilt und miteinander vermischt, die nicht nur jede Symmetrie und Schönheit der Form zerstöre, sondern auch die Gefahr heraufbeschwöre, daß wichtige Teile des Gebäudes unter dem Übergewicht anderer Teile zusammenbrechen können. […]
Die Vereinigung aller Gewalten, der gesetzgebenden, vollziehenden und richterlichen, in den gleichen Händen, mögen es die Hände eines einzelnen oder einiger weniger oder vieler sein, und mag ihnen die Macht im Erbgang, durch Selbsternennung oder durch Wahl zugefallen sein, kann mit vollem Recht als das Musterbild der Tyrannei bezeichnet werden. Könnte der vorgeschlagenen Verfassung der berechtigte Vorwurf gemacht werden, daß sie eine solche Vereinigung der Gewalten oder auch nur eine Vereinigung der Machtbefugnisse, die zu einer solchen Vereinigung führen könnte, begünstige, so wäre kein weiteres Argument nötig, um ihre allgemeine Ablehnung zu rechtfertigen. Meiner Überzeugung nach wird es jedoch jedermann sehr bald klar werden, daß dieser Vorwurf nicht aufrecht erhalten werden kann und daß der Grundsatz, auf den er sich bezieht, völlig mißverstanden und falsch ausgelegt wurde.
Artikel 47 (James Madison).
Gegen Machtmißbrauch
Aber die wichtigste Sicherung gegen die allmähliche Konzentration der verschiedenen Gewalten in einem Zweig besteht darin, dafür zu sorgen, daß die Männer, welche die einzelnen Zweige verwalten, die notwendigen Mittel besitzen und ein persönliches Interesse daran haben, sich den Übergriffen der anderen Zweige zu widersetzen. In diesem wie in allen anderen Fällen müssen die Maßnahmen zur Verteidigung der voraussichtlichen Stärke des Angriffs entsprechen. Ehrgeiz muß durch Ehrgeiz unschädlich gemacht werden. Das persönliche Interesse muß mit den verfassungsmäßigen Rechten des Amtes Hand in Hand gehen. […] Entwirft man […] den Plan einer Regierung, die von Menschen über Menschen ausgeübt werden soll, so liegt die große Schwierigkeit darin, daß man zuerst die Regierung instand setzen muß, die Regierten zu überwachen und im Zaum zu halten und dann die Regierung zwingen muß, sich selbst zu überwachen und im Zaum zu halten. Die Abhängigkeit vom Volk ist zweifellos das beste Mittel, um die Regierung im Zaum zu halten.
Artikel 15 (James Madison).
Auszüge aus Felix Ermacora (Hg.), Der Föderalist, Wien 1958, S. 93 ff.
Kompetenzen und Funktionen
Wer die amerikanische Präsidentschaft als "schwersten Job der Welt" bezeichnet, begründet dies im allgemeinen mit der Vielfalt ihrer Aufgaben: Der Präsident der Vereinigten Staaten ist Staatsoberhaupt und Regierungschef in einem, oberster Verwaltungschef der gesamten Bundesbürokratie, Oberbefehlshaber der Streitkräfte und höchster Diplomat der USA, dazu gemäß dem oben erwähnten Verfassungsprinzip der checks and balances Anreger bzw. Widerpart im Gesetzgebungsprozeß. Er ist also gehalten, beständig die Zusammenarbeit mit dem Kongreß zu suchen, um diesen zu legislativen Entscheidungen zu veranlassen, die dem politischen Programm des Weißen Hauses entsprechen. Und überdies gilt er als Chef seiner Partei, auch dann, wenn ein anderes Parteimitglied die Rolle des formellen Parteivorsitzenden innehat.
Als Staatsoberhaupt verkörpert er die Nation und vertritt die USA gegenüber auswärtigen Mächten. Allein schon diese Aufgabe ist bloß mit hohem Zeit- und Kräfteaufwand zu bewältigen, richtet doch die Gesellschaft erhebliche Repräsentationsanforderungen an den "Ersatzmonarchen", wollen seine Landsleute ihm doch nahe sein und ihn als "Ersten unter Gleichen" in ihrer Mitte wissen. Der Präsident soll sich einem ausgeprägten "Hofzeremoniell" unterwerfen, gleichzeitig aber seine demokratische Gesinnung durch intensive Kommunikation mit den Bürgern des Landes bekunden.
Als Regierungschef erfüllt er die einem Premierminister (Bundeskanzler) vergleichbaren Aufgaben und Funktionen: Er bestimmt die Richtlinien der Politik und muß beständig politische Entscheidungen treffen, die den Innen- und Außenbereich der USA angehen. Ihm steht kein "Kabinett" im europäischen Sinne mit "Ministern" zur Seite, die ihre Ressorts eigenverantwortlich leiten, sondern eher ein beratender Ausschuß mit "Sekretären", die er nach eigenem Belieben ernennen, entlassen oder austauschen kann, sieht man vom verfassungsmäßigen Mitwirkungsrecht des Senats bei der Bestellung von secretaries ab, der aber nur ausnahmsweise personalpolitische Absichten des Präsidenten vereitelt.
Als oberstem Verwaltungschef untersteht dem Präsidenten ein gigantischer Apparat von Ämtern, Behörden und Kommissionen. Er hat die gewissenhafte Anwendung der Gesetze durch die Bürokratie zu kontrollieren und zu verantworten. Noch immer besetzt er viele Spitzenpositionen des öffentlichen Dienstes in Washington mit Vertrauensleuten, betreibt also Ämterpatronage großen Stils, auch wenn inzwischen in die Mehrzahl der Verwaltungsstellen Bewerber nach beamtenrechtsähnlichen Richtlinien berufen werden. Für europäische Verhältnisse ist die Besetzung der politischen Leitungsebene bei Ministerien und Behörden durch den frisch gewählten Präsidenten ungewöhnlich breit. Die Zahl der präsidialen Berufungen ist von 71 (1933) auf 527 (1984) angestiegen, Botschafter und Staatsanwälte nicht eingerechnet; dazu kommen weitere 2500 sogenannte "Vertrauenspositionen" im Bereich der Exekutive, die von Behördenchefs und Präsidentenstab besetzt werden. Die politische Durchsetzung der Bürokratie hat also im Verlauf der letzten Jahrzete auf Kosten des Karrierebeamtentums beträchtlich zugenommen.
Welche Last auf dem Präsidenten als Oberbefehlshaber der bewaffneten Streitkräfte ruht, mag allein der Hinweis auf seine ausschließliche Verfügungsgewalt über das atomare Waffenpotential der Vereinigten Staaten verdeutlichen. Als "höchster Diplomat" soll er mit seinem Apparat die Rolle des eigentlichen außenpolitischen Entscheidungsträgers wahrnehmen.
Im Bereich der Legislative ist er gehalten, in regelmäßigem Abstand vor dem Kongreß über die Lage der Nation zu berichten und dabei beiden Häusern seine politischen Zielvorstellungen bzw. seine Gesetzgebungswünsche persönlich vorzutragen (state of union message). Vom Kongreß beschlossenen Gesetzen muß er durch seine Unterschrift Rechtskraft verleihen oder - wenn er sie mißbilligt - zu neuerlicher Beschlußfassung an die Legislative rückverweisen (veto competence).
Herrschaftsinstrumente
Wie kann der Präsident die Vielzahl der Funktionen, wie die steigenden gesellschaftlichen Erwartungen erfüllen, die an das Weiße Haus gestellt werden? Im Kampf um die Durchsetzung seiner Politik kann er auf die einzigartige Qualität seiner Legitimation verweisen, die ihm aus der Wahl durch das Gesamtvolk der USA erwächst; sie hilft ihm gelegentlich bei Auseinandersetzungen mit einem widerborstigen Kongreß oder allzu aufdringlichen Lobbyisten. Er darf sich ebenso auf den festverwurzelten Verfassungsrespekt verlassen, der auch gegnerische Mehrheiten im Parlament präsidentielle Kompetenzen respektieren heißt. Enge Kontaktpflege mit der Öffentlichkeit kann Prestige und Einfluß des Amtes erhöhen. Überzeugungs- und Tatkraft des Präsidenten sowie weiser Gebrauch der anvertrauten Macht vergrößern seine Herrschaftschancen. Letztlich entscheidet über Erfolg und Mißerfolg des Präsidenten sein Geschick im Umgang mit dem Kongreß, sein fester Zugriff auf die eigene Partei und sein Talent, ebenso geeignete wie loyale Mitariter zu finden und die Vielzahl der um das Weiße Haus zentrierten Ämter, Behörden und Kommissionen zu koordinieren, zu überwachen und der Förderung seiner Zielsetzungen zu verpflichten.
Im Jahre 1939 bot der Kongreß dem Präsidenten durch den Reorganization Act die Möglichkeit, sich einen eigenen Apparat, das Executive Office of the President (EOP), zu schaffen, eine Organisation, die bald darauf weit über die vorhandenen Ministerien und die engeren Mitarbeiter des Weißen Hauses hinausreichte und zur Ansammlung ganz unterschiedlicher Beratungs-, Kontroll-, Regulierungs- und Verwaltungsbehörden unter einem Dach führte. Im Rahmen dieses Apparates hat sich mit dem White House Office, der eigentlichen Präsidialkanzlei, eine Superkoordinierungs- und Überwachungszentrale für den gesamten Regierungsapparat herausgebildet, die in den letzten Jahrzehnten zielstrebig ausgebaut worden ist und heute mehr als 500 Mitarbeiter zählt.
Die Fülle der kritischen Auseinandersetzungen mit dem Präsidentenamt in seiner heutigen Form läßt sich im wesentlichen auf die Formel bringen, es seien im Weißen Haus zuviel politische Aufgaben konzentriert und ihre angemessene Ausübung überfordere die Kräfte eines Einzelnen.
Probleme der Präsidentschaft
Wenn die Verfassungsväter dem Präsidenten die beschriebene Vielzahl der Funktionen überwiesen, so gingen sie von einer Republik aus, die außenpolitisch kaum aktiv werden und auch im Inneren bloß über begrenzte Befugnisse verfügen sollte. Sie glaubten jedenfalls, es werde auf lange Sicht noch der Kongreß die erste Geige im Machtkonzert der Gewalten spielen. Was sie nicht vorhersehen konnten, war der in allen westlichen Demokratien seit Ende des letzten Jahrhunderts - in den USA erst in den frühen dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts - beginnende Wandel vom liberalen Nachtwächterstaat zum modernen Leistungs- und Daseinsvorsorgestaat. Dieser Wandel der Staatsfunktionen brachte eine Vermehrung der Staatsaufgaben solchen Ausmaßes mit sich, daß sie nur noch von Großbürokratien bewältigt werden konnten.
Weiterhin setzte in diesem Jahrhundert eine bis dahin unbekannte Internationalisierung der Politik ein und die internationale Zusammenarbeit gewann erheblich an Bedeutung. Dieser Prozeß hat die Machtposition der verhandlungsführenden Exekutive gegenüber dem Parlament gestärkt (ganz zu schweigen von ähnlich gerichteten Auswirkungen der zwei Weltkriege). Wenn heute politische Entscheidungen nur noch unter Einsatz hochentwickelter Planungsinstrumente getroffen werden können, bewirkt dies einmal mehr die Machtverlagerung zur Exekutive, die über den effektiveren Apparat zur Vorbereitung solcher Entscheidungen verfügt. Nicht zufällig hat der amerikanische Historiker Arthur Schlesinger Jr. von einer "imperialen Präsidentschaft" gesprochen, als er die Administrationen der sechziger Jahre analysierte. Damals verbanden sich objektiv begründete Machterweiterungen des Weißen Hauses mit persönlichen Herrschaftsansprüchen und Machtanmaßungen Lyndon B. Johnsons und Richard Nixons zu einer präsidentiellen Machtfülle, die seher vom Kongreß oder dem Obersten Bundesgericht an den Rändern wieder zurückgeschnitten worden ist. Dies warf die bis heute aktuelle Frage auf, ob die präsidentielle Machtfülle das von den Verfassungsvätern fein gesponnene Netz der Gewaltenbalance auf Dauer beschädigt.
Zweifel zielen auch in eine andere Richtung. Im Zeichen des modernen Daseinsvorsorgestaates und unter den Bedingungen aktiver Weltpolitik muß die Kraft eines Einzelnen, Gegenstände zu ordnen, Aufgaben zu überblicken und zu bewältigen, Methoden abzuwägen und Ziele zu setzen, hinter der Komplexität des Politischen zurückbleiben. Dabei gerät auch die Vielzahl der Hilfsinstrumente, der Stäbe, Ämter, Behörden und Kommissionen zur zwar unentbehrlichen, gleichwohl nicht mehr zu bewältigenden Bürde. Die Sorge wächst, der Präsident könnte die Fäden der Politik nicht mehr zusammenhalten, die Elemente des Exekutiv-Apparates würden sich in unheilvoller Weise verselbständigen: Seit den sechziger Jahren haben die europäischen Verbündeten der USA immer wieder über die außenpolitische "Sprunghaftigkeit" einzelner Administrationen geklagt, die zuweilen aus dem ungeordneten Neben- oder gar Gegeneinander der mit internationalen Fragen befaßten Agenturen der Exekutive - Außenministerium, Pentagon, weitere Ministerien, Geheimdiete, unabhängige Regierungsbehörden, persönliche Berater des Präsidenten und andere mehr - erwächst.
Daß die amerikanische Verfassung darauf abzielt, nirgendwo im politischen System unkontrollierbare und auf Kosten anderer Gewalten expandierende Institutionen oder Apparate entstehen zu lassen, daß sie Ausübung und Gebrauch politischer Macht nach Kräften zu erschweren sucht, haben auch Präsidenten immer wieder erfahren. Der amerikanische Politikwissenschaftler Richard Neustadt hat in einem Buch über "Die Macht des amerikanischen Präsidenten" darauf hingewiesen, der Herr des Weißen Hauses verfüge über relativ wenig institutionelle Druckmittel, wenig eindeutige Machtbefugnisse, um seine Ziele im politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozeß der USA durchzusetzen. "Indirekte Macht" stehe ihm vor allem zu Gebote, falls er die Kunst der Überredung, der Überzeugung, des eindrücklichen Appellierens an die Öffentlichkeit beherrsche - die ihm gegebenenfalls gegen einen widerspenstigen Kongreß durch Außendruck auf die Parlamentarier zu Hilfe kommen müsse. In den letzten Jahrzehnten hat eine Skandalserie - vom "tergate-Debakel" der Nixon-Administration über die "Iran-Contra-Affäre" der Reagan- und Bush-Regierungen bis hin zur "Whitewater-Verwicklung" von Bill und Hillary Clinton - im Verein mit dem verhängnisvollen Vietnam-Engagement das Ansehen des Amtes beschädigt und die Verehrung, welche die Amerikaner traditionell dem Weißen Haus entgegenbrachten, gemindert. Die Folge ist, daß sich die oben erwähnten Chancen "indirekter Machtausübung" drastisch verringert haben.
Andererseits richtet dieselbe, zumindest partiell desillusionierte Gesellschaft immer wieder unvernünftig überzogene Erwartungen an den jeweiligen Präsidenten, denen er angesichts beschränkter Machtressourcen nicht entsprechen kann. Überschwengliche Hochstimmung am Beginn einer neuen Regierung und rasch einsetzender Katzenjammer über nicht eingelöste Hoffnungen liegen eng beieinander, umso mehr, als die Massenmedien solche Erwartungen oder Stimmungen noch verstärken.
In diesem Zusammenhang spielt das Fernsehen eine kaum zu überschätzende Rolle. Nicht selten baut es die Person des Präsidenten wie einen Hollywood-Helden auf, um ihn später mit der gleichen Überzogenheit als "Versager" zu brandmarken.
Es sind also vielfach unrealistische Erwartungen an die Problemlösungskapazität des Weißen Hauses im Verein mit dem Ansehensverlust der Administrationen, die den multifunktionalen "job" des Präsidenten zu einer noch schwerer zu tragenden Bürde haben werden lassen. Demoskopische Daten und die Wahlstatistik belegen die wachsende Entfremdung zwischen der Gesellschaft und den politischen Institutionen des Landes, in diesem Falle der Präsidentschaft. Ob man "Washington" zutrauen könne, normalerweise "das Richtige zu tun", wollen Meinungsumfragen immer wieder von den amerikanischen Bürgern wissen. 1953 bejahten noch 73 Prozent die gestellte Frage, 1994 bloß noch 24 Prozent. Noch zu Beginn der sechziger Jahre beteiligten sich rund zwei Drittel der im Wahlalter befindlichen Bürger an Präsidentschaftswahlen; heute hat sich die Wahlbeteiligung bei bestenfalls 50 Prozent eingependelt (obwohl die in Amerika erforderlichen Registrierungsprozeduren - man bekommt nicht wie bei uns automatisch den Wahlschein mit der Post - zwischen vereinfacht worden sind).
Immer mehr Wähler haben zudem in den vergangenen Jahrzehnten ticket splitting betrieben, also Kandidaten verschiedener Parteien für das Weiße Haus einerseits und den Kongreß andererseits gewählt. Während 1948 noch 62 Prozent der Wähler auf den verschiedenen Politikebenen (Bund, Länder, Kommunen) ausschließlich für Kandidaten "ihrer" Partei votierten und 38 Prozent ihre Stimmen auf Bewerber beider Parteien verteilten, hatte sich dieses Verhältnis schon 1980 nahezu umgekehrt. Herausgekommen ist dabei auf nationaler Ebene das sogenannte divided government: Die republikanischen Präsidenten Ronald Reagan und George Bush hatten es mit einem demokratisch beherrschten Kongreß zu tun, der Demokrat Bill Clinton muß sich mit einem republikanisch kontrollierten Parlament herumschlagen. Divided government hat das Regieren zusätzlich erschwert. In jüngster Zeit ist dies vor allem an den lähmenden Auseinandersetzungen um eine Gesundheits- und Haushaltsreform in Washington sichtbar geworden.
Bleibt noch die wachsende Anzahl der Stimmen zu nennen, die das Ausleseverfahren der Präsidentschaftskandidaten grundsätzlich kritisieren. Fest steht, daß die gesetzlichen Regelungen der Wahlkampffinanzierung, der Zerfall der traditionellen Parteiorganisationen und die wachsende Zahl der "Vorwahl"-Staaten die Kandidaten für das Weiße Haus zu einem immer langwierigeren und mehr Kräfte verschleißenden Kampf um die Wählergunst zwingen. Sie erfordern physische Leistungen, die wenig über die künftige Amtseignung aussagen. Überdies besteht die Gefahr, daß das Medienzeitalter Außenseiter ins Weiße Haus befördert, deren intellektuelle Gaben und Führungskraft für den "schwersten Job der Welt" nicht ausreichen.
Kongreß
Der Kongreß ist die gesetzgebende Gewalt (legislative power) im politischen System der Vereinigten Staaten. Er besteht aus zwei Kammern, dem Senat und dem Repräsentantenhaus. Jeder der 50 Einzelstaaten entsendet ungeachtet der Einwohnerzahl zwei Vertreter in den Senat, die von der stimmberechtigten Bevölkerung dieser Staaten gewählt werden. Um die Kontinuität der Arbeit in diesem wichtigen Verfassungsorgan zu gewährleisten, wird nicht der Senat in seiner Gesamtheit in regelmäßigen Abständen neu gewählt, sondern müssen sich alle zwei Jahre je ein Drittel der Senatoren einer Wiederwahl stellen (bzw. nach Ablauf ihres Mandats ausscheiden).
Das Repräsentantenhaus hat 435 Abgeordnete, die für zwei Jahre gewählt werden. Die Einzelstaaten entsenden etwa so viele Mitglieder, wie es ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung entspricht. Bei der Wahl von 1994 entfiel auf etwa 570000 Einwohner ein Abgeordneter. Jeder Staat wird jedoch von mindestens einem Abgeordneten vertreten, auch Alaska mit ca. 550000 Einwohnern.
Der verfassungsgebende Konvent von Philadelphia und die einschlägigen Kommentare der Federalists ließen am Ausgang des 18. Jahrhunderts keine Zweifel aufkommen, daß im gewaltenteiligen Orchester des amerikanischen Herrschaftssystems der Kongreß den Part der ersten Geige spielen sollte.
Zwei Kammern
Im Repräsentantenhaus verkörpert sich die Idee demokratischer Volkssouveränität: Vom Volk direkt gewählt, durch Kürze der Amtsdauer (zweijährige Legislaturperiode) zu ständigem Kontakt mit der Wählerschaft angehalten, gibt es der jeweiligen öffentlichen Meinung des Landes Ausdruck.
Der Senat soll auch die Interessen der Einzelstaaten in die Entscheidungsprozesse der Bundespolitik einbringen, wobei die kleineren Staaten 1787/88 erfolgreich darauf bestanden, daß jeder Staat die gleiche Anzahl von Senatoren entsendet. Laut US-Verfassung besteht deshalb die erste Kammer "aus je zwei Senatoren jedes Einzelstaates, die von dessen gesetzgebender Körperschaft auf sechs Jahre gewählt werden" (Artikel I, Abschnitt 3). Die indirekte Wahl, die längere Amtsdauer der Senatoren und die Überschaubarkeit der parlamentarischen Körperschaft sollten den Einzug kompetenter Volksvertreter in den Senat gewährleisten, politische Sachkenntnis befördern, langfristige Planung ermöglichen, die Perspektiven politischen Nachdenkens weiten, kurzum ein Gegengewicht schaffen zum Repräsentantenhaus mit seiner unmittelbaren Bindung an das Volk.
Freilich hat auch hier die Dynamik der Demokratie den Verfassungsvätern einen Strich durch die Rechnung gemacht: 1913 trat der Zusatzartikel XVII in Kraft, nachdem die stimmberechtigte Bevölkerung jedes Einzelstaates die Senatoren wählt. Daneben hat die wachsende Zahl der Mitgliedsstaaten der Union den Kreis der Senatoren bis auf jene hundert ausgeweitet, die heute die 50 Bundesstaaten der USA repräsentieren.
Parlamentsmacht
Die Macht der Legislative dokumentierte sich in ihrer Kompetenzfülle, voran dem finanziellen Bewilligungsrecht, neben der Gesetzgebungsbefugnis wichtigster Garant dauerhafter Parlamentsmacht. Während in Europa die Entscheidung über den Haushalt - Einkünfte und Ausgaben des Staates - von den Parlamenten fast völlig auf die jeweiligen Regierungen übergegangen ist, hat der US-Kongreß erfolgreich seine power of purse verteidigt; 1974 schuf er sich mit dem Congressional Budget Office ein Hilfsinstrument, das den Kongreßmitgliedern und Ausschüssen bei der Arbeit an der Erstellung des Haushalts behilflich sein soll.
Selbst im Bereich der Außen- und Personalpolitik - aus europäischer Sicht unbestritten in der Kompetenz der Regierung - sollte der Kongreß teils entscheiden, teils durch Mitwirkungsbefugnisse mindestens kontrollieren. Wo sich den Verfassungsvätern die Spannweite der Außenpolitik zu auswärtigen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen verengte, betrauten sie folgerichtig den Kongreß mit dem Recht, "den Handel mit fremden Ländern ... zu regulieren" (Artikel I, Abschnitt 8 US-Verfassung). Im übrigen bedurften und bedürfen bis zum heutigen Tage alle von der Regierung ausgehandelten internationalen Verträge der Ratifizierung durch eine Zweidrittelmehrheit des Senats. Schließlich vermochte auch parlamentarischer Einfluß, "Armeen aufzustellen und zu unterhalten", "Reglements für Führung und Dienst der Land- und Seestreitkräfte zu erlassen", Einwanderungs- und Naturalisationsvorschriften zu fixieren, Zölle zu erheben, "Krieg zu erklären" und anderes mehr den Einfluß des Kongresses in der Außenpolitik zu verankern.
Die Absichten der Gründerväter zielten vorrangig nicht auf die Handlungsfähigkeit der Exekutive, sondern auf Verhinderung von Machtmißbrauch. Auch in der heiklen Sphäre des Ämter- und Personalwesens sollte der Präsident allein "auf Anraten und mit Zustimmung" des Senats handeln können. Durch die verfassungsmäßige Verpflichtung, daß alle Personalstellen im Bundesdienst, sowohl für den Bereich der Innen- wie der Außenpolitik, nur mit Zustimmung des Senats besetzt werden dürfen, besitzt die Legislative eine breitgefächerte Kontrolle über das exekutive Personal. Allerdings hat sie mit Blick auf eine effiziente Verwaltung ihre Kompetenz freiwilliger Beschränkung unterworfen und seit der Jahrhundertwende untergeordnete Bürokraten durch Eignungstests auswählen lassen, so daß die diesbezüglichen Ämterbesetzungen von der Zustimmungsnotwendigkeit entbunden wurden.
Sollten trotz aller verfassungsrechtlicher Vorkehrungen die gegen den Übermut der Regierenden gezogenen Dämme einmal brechen, so stand und steht dem Kongreß noch immer die Waffe der Amtsanklage, das sogenannte impeachment, zu Gebote, wobei die Verfassung neben Präsident und Vizepräsident "all civil officers" der Vereinigten Staaten benennt, gegen die ein impeachment-Verfahren eingeleitet werden kann. Die meisten Verfahren wurden bislang gegen Bundesrichter eingeleitet, ein halbes Dutzend von ihnen wurde vom Kongreß des Amtes enthoben und für zukünftige Positionen disqualifiziert.
1868 leitete der Kongreß gegen den damaligen Präsidenten Andrew Johnson, einen Südstaatler, aus politischen Motiven ein Amtsenthebungsverfahren ein, das aber knapp scheiterte (die erforderliche Zweidrittelmehrheit im Senat wurde um eine Stimme verfehlt). Im allgemeinen reichte häufig schon die bloße Androhung einer Amtsklage, um einen Amtsinhaber zum Rücktritt zu bewegen. Im Falle Richard Nixons, der des Machtmißbrauchs und anderer verfassungsrechtlicher Verfehlungen bezichtigt wurde, bedurfte es aber schon der Einleitung der Prozedur, ehe er 1974 "freiwillig" das Weiße Haus verließ. Daß von der impeachment-Waffe selten Gebrauch gemacht wurde, hing und hängt auch damit zusammen, daß die Tätigkeit der Exekutive strikter Kontrolle durch parlamentarische Untersuchungsausschüsse unterworfen blieb, und überdies die "vierte Gewalt" in Gestalt der Massenmedien ein so rigides Wächteramt gegenüber den politischen Machtträgern ausübt, daß Verfehlungen im allgemeinen auch auf dieser Ebene aufgedeckt werden.
Solche Machtfülle des Kongresses barg freilich die Gefahr der Tyrannei der Legislative in sich. Auch hier mußten Riegel vorgeschoben werden. So weist die Verfassung dem Präsidenten ein aufschiebendes Vetorecht gegen Gesetzesbeschlüsse des Kongresses zu, das nur durch Zweidrittelmehrheiten in beiden Parlamentskammern überstimmt werden kann. Daß die notwendigen Stimmen schwer aufzubringen sind, belegt die Statistik: Von den insgesamt 1066 Vetos, die Roosevelt, Truman und Eisenhower zwischen 1933 und 1961 aussprachen, wurden bloß 23 (etwa 2,2 Prozent) überstimmt. Bei den Präsidenten Nixon, Ford, Carter, Reagan und Bush sind erheblich mehr ihrer Vetos am Kongreß gescheitert, was unter anderem mit dem oben erwähnten Phänomen des divided government zu erklären ist. Früh schon haben auch die Gerichte, an ihrer Spitze der Supreme Court, den verfassungsrechtlich unscharfen Anspruch durchgesetzt, parlamentarische Entscheidungen ihrer Normenkontrolle zu unterwerfen, gegebenenfalls also gesetzgeberische Entscheidungen ganz oder teilweise der Verfassungswidrigkeit zu zeihen.
Die vertikale Gewaltenteilung hat Parlaments- oder Präsidentenmacht stets eingedämmt: Im föderalistischen System der USA wachten Einzelstaaten und Kommunen stets nachdrücklich über die Einhaltung der ihnen zustehenden Rechte. Und nicht zuletzt bauten die Verfassungsväter eine sogenannte Intraorgan-Kontrolle in das Parlament ein. Seine Zweiteilung und der daraus entspringende Zwang zum Zusammenwirken beider Kammern beim Geschäft der Gesetzgebung haben Extremismus in jeder Form erschwert und die Kunst des Kompromisses gedeihen lassen, die als heilsames Mittel gegen einseitige Machtanmaßung wirkt.
Befugnisse
Auch wenn manche Amerikaner einen Machtverlust des Kongresses in unserem Jahrhundert beklagen, gilt die amerikanische Legislative immer noch als "mächtigstes Parlament der Welt", als "Arbeitsparlament" schlechthin, das möglichst autonom seine Gesetzgebungsfunktion ausfüllen und im Sinne begrenzter Herrschaft die Exekutive überwachen will.
Die Gesetzgebungsbefugnis liege beim Kongreß, erklärt die US-Verfassung. Dies bedeutet zunächst, daß die zwei Kammern den Ausgangspunkt aller formellen Gesetzgebungsarbeiten bilden, formulierte Gesetzesinitiativen nur vom Kongreß, von jedem Abgeordneten oder Senator, ausgehen können. Freilich unterbreitet der Präsident bei seiner jährlichen Botschaft zur Lage der Nation vor dem Kongreß gesetzgeberische Anregungen; doch bleibt er im wesentlichen auf informelle Kanäle vom Weißen Haus zum Kapitol, dem Sitz des Kongresses, angewiesen, wenn er Richtung und Inhalt der parlamentarischen Gesetzgebungsarbeit bestimmen will. Präsidenten pflegen Kontakte zu einflußreichen Parlamentariern beider Parteien, laden sie zu Gesprächen in ihren Amtssitz ein, versprechen (finanzielle) Unterstützung für anstehende Wahlkampagnen, deuten vielleicht auch einmal den möglichen Entzug von Vergünstigungen an und suchen auf vielfältige Weise ihre politischen Zielsetzungen im Kongreß durchzusetzen.
Das Budgetrecht des Parlaments ist bis zum heutigen Tag ein wichtiges Instrument zur Einwirkung auf die Exekutive geblieben. Obwohl der Kongreß gemeinhin dem Haushaltsentwurf des Budgetbüros des Präsidenten folgt, verfügt er doch über autonome Freiheiten im Bereich der Haushaltsgestaltung, wie sie etwa im politischen System der Bundesrepublik unbekannt sind: Er kann Ausgaben für einen beliebig abgesteckten Zeitraum genehmigen, in Bewilligungsgesetze Verfügungen jedweden Inhalts aufnehmen, ja sogar durch Nicht-Bewilligung gesetzlich festgelegter Ausgaben eine Änderung des bestehenden Rechtszustandes herbeiführen. Seit 1974 verfügt der Kongreß über ein parlamentseigenes Haushaltsbüro (Congressional Budget Office), in dem mehrere hundert Haushaltsexperten den Abgeordneten und Senatoren zuarbeiten und damit deren Chancen erweitern, sich im Dschungel heutiger Budgetentwürfe zurechtzufinden, wirksame Kontrolle auszuüben oder alternative Konzeptionen in einzelnen Politikfeldern zu verwirklichen.
Die Budgethoheit offenbart die Doppelfunktion des Kongresses, sowohl an der politischen Gestaltung der Republik mitzuwirken als auch die exekutive Gewalt parlamentarischer Kontrolle zu unterwerfen. In der amerikanischen Präsidialdemokratie mit ihrer strikten Trennung von Exekutiv- und Legislativorganen ist der traditionellen Kontrollfunktion des Parlaments viel größeres Gewicht zugewachsen als in den parlamentarischen Regierungssystemen Europas, wobei freilich auch der Kongreß unter dem Wuchern der Bürokratie, der Vielschichtigkeit der Politik und mancherlei Informationsdefiziten leidet. Immerhin ist es auch in den vergangenen Jahren parlamentarischen Untersuchungsausschüssen immer wieder gelungen, Skandale, Affären oder Kompetenzüberschreitungen im exekutiven Apparat offenzulegen und zu ahnden.
Wandlungen der Rolle des Präsidenten
Früher klagten manche über die sogenannte ”imperiale Präsidentschaft”, doch inzwischen ist der Pendelausschlag zu weit in die entgegengesetzte Richtung gegangen. Wir haben keine imperiale, sondern eine gefährdete Präsidentschaft. Unter den jetzigen Gegebenheiten, zu denen auch einige irregeleitete »Reformen« zählen, kann der Präsident nicht effektiv arbeiten. Dies ist eine sehr ernste Entwicklung, die unserem nationalen Interesse zuwiderläuft.
Seit dem Jahr 1949, als ich erstmals nach Washington ging, hat sich viel geändert; die stärksten Umgestaltungen gab es im Verhältnis zwischen dem Präsidenten und dem Kongreß. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg erreichte die Präsidentschaft einen Höhepunkt; der Kongreß verhielt sich sehr kooperativ, insbesondere in der Außenpolitik. Heutzutage hat der Präsident beim Kongreß längst nicht mehr den Einfluß, den er vor dreißig Jahren hatte, nicht einmal in Angelegenheiten, welche die nationale Sicherheit betreffen. Das Teamwork, das in den fünfziger Jahren vorhanden war, gibt es nicht mehr, selbst wenn der Präsident und die Kongreßmehrheit derselben Partei angehören.
Diese Veränderung ist hauptsächlich auf die Führungsschwäche im Kongreß zurückzuführen. Die Parteiführer sind nicht imstande, ihre Mannschaft auf die Verfolgung wichtiger Ziele einzuschwören. [...] Die Fähigkeit des Kongresses, selbst unter schwierigen Umständen, bei denen das nationale Interesse auf dem Spiel steht, seinen Aufgaben nachzukommen, hat darunter sehr gelitten [...].
Die zweite Hauptschwäche der Präsidentschaft beruht auf der Unfähigkeit des Weißen Hauses, die ausgedehnte Bundesbürokratie unter seine Kontrolle zu bekommen. Für einen Präsidenten ist äußert frustrierend, wenn er einem Kabinettsmitglied eine Anweisung erteilt und feststellen muß, daß diese in der Praxis ganz anders gehandhabt wird. Mir ist dies widerfahren, und ich bin sicher, daß es auch bei allen anderen Präsidenten geschehen ist.
In einzelnen Bundesstaaten und in verschiedenen Gegenden gibt es Leute in bürokratischen Vormachtstellungen, die die Dinge auf ihre Weise regeln wollen. Sie entwickeln dabei großes Geschick. Seit Jahren haben sie die Anordnungen demokratischer wie auch republikanischer Präsidenten ignoriert. Und im Westflügel des Weißen Hauses sitzt ein Präsident und fragt sich: ”Wie konnte das passieren”?
Es wäre gut, wenn ein Präsident jemanden entlassen könnte, der gegen Anordnungen und Richtlinien verstoßen hat. Er müßte sagen können: »Herr Minister, dieser Mann hat Ihre Anweisung und die Anweisung des Präsidenten mißachtet. Er ist sofort aus seinem Amt zu entfernen [...]«
Präsident zu sein, ist alles andere als einfach. Trotz der schweren Belastungen kann aber nicht behauptet werden, eine einzelne Person sei gar nicht imstande, die Aufgaben zu bewältigen. Das Gerede, daß man eigentlich zwei Präsidenten brauche, habe ich gründlich satt. Mir leuchtet das nicht ein. Es stimmt schon: Die Aufgabe erfordert einen Zeitaufwand von zwölf bis vierzehn Stunden pro Tag. Aber was ist schon dabei? Der Präsident der Vereinigten Staaten muß bereit sein, soviel Zeit aufzubringen. Wer meint, er könne dort morgens um neun an die Stempeluhr gehen und um fünf Uhr Feierabend machen, hat sich geirrt. Wir wählen keine Präsidenten, die ein derartiges Leben führen wollen.
Natürlich gibt es viel Zeitverschwendung. Am schlimmsten sind die zahllosen zeremoniellen Aufgaben und Repräsentationspflichten, die routinemäßig wahrgenommen werden müssen. Sie nehmen fünfzehn bis zwanzig Prozent der Arbeitszeit eines Präsidenten in Anspruch, in Wahljahren sogar noch mehr. Ich glaube aber, daß sie einfach erledigt werden müssen. Geschähe dies nicht, dann bekäme die Öffentlichkeit eine falsche Vorstellung vom Präsidenten: daß er sich im Westflügel des Weißen Haus versteckt und mit dem Volk nicht in Berührung kommen will. Betrachtet man die Sache jedoch unter ”Kosten-Nutzen”-Gesichtspunkten, dann sollte sich der Präsident in der ihm zur Verfügung stehenden Zeit ganz den Angelegenheiten widmen, die im Oval Office zur Behandlung anstehen.
Stellungnahme von Ex-Präsident Gerald Ford (übersetzt von Rüdiger Hipp), in: TIME MAGAZINE vom 10. November 1980, S. 30/31.
Organisations- und Steuerungsprinzipien
Als "Arbeitsparlament", das seine Aufgaben autonom bewältigt und über wesentliche Machtbefugnisse verfügt, bedarf der Kongreß umfangreicher wissenschaftlicher Hilfsdienste und arbeitstechnischer Apparate sowie eines hohen Maßes an Spezialisierung. Dies gilt für beide Häuser, für die Vielzahl der Ausschüsse und Unterausschüsse und die einzelnen Abgeordneten und Senatoren. Mit der Kongreßbibliothek (Library of Congress) steht dem Parlament die weltbeste Bibliothek zur Verfügung. Der Congressional Research Service (CRS) als parlamentarischer Hilfsdienst verfügt über einen spezialisierten Stab von mehr als 800 Mitarbeitern. Er hilft dem Kongreß durch technisch-juristische Untestützung beim Entwurf und der Abfassung von Gesetzen, beantwortet Anfragen aus dem Parlament (ca. 2000 pro Tag) und vermittelt Daten, Informationen und Statistiken.
Daneben sind umfangreiche Mitarbeiterstäbe am Werk, um Wirksamkeit und Autonomie der Kongreßarbeit zu gewährleisten. 1990 hat die Legislative insgesamt mehr als 30000 Mitarbeiter beschäftigt. Die für Ausschüsse und Unterausschüsse tätigen Stäbe sind per Gesetz wiederholt vergrößert worden. Jeder Abgeordnete und jeder Senator arbeitet mit einem für deutsche Verhältnisse unvorstellbar großen Kreis von Helfern und wissenschaftlichen Angestellten. Senatoren großer Einzelstaaten beschäftigen zuweilen über hundert Mitarbeiter in ihrem Stab.
Ohne Arbeitsteilung und Spezialisierung bliebe der Kongreß ein kraftloser Riese. Deshalb organisiert und aktiviert er sich in einer Vielzahl von Ausschüssen (Ständigen Ausschüssen bzw. Unterausschüssen oder Ad-hoc-Komitees). Sie leisten die eigentliche Arbeit; sie wirken machtbegrenzend, weil sie bei der parlamentarischen Beschlußfassung zusammenwirken müssen (und oft sehr gegensätzliche Auffassungen schon deshalb verfechten, weil strikte Fraktionsdisziplin unbekannt ist). Schließlich dienen sie der Vorbereitung politischer Karrieren, erwerben sich doch Kongreßmitglieder Problemkenntnis, Spezialwissen, politische Taktik im Rahmen der Ausschußarbeit. Gelegentlich können Politiker über parlamentarische Untersuchungstätigkeiten sogar nationales Ansehen erlangen, wie das Beispiel der Brüder John F. und Robert Kennedy in den fünfziger Jahren zeigt, als sie in einem Untersuchungsausschuß kriminelle Machenschaften einzelner Gewerkschaftsmitglieder enthüllten.
Ein stabiles, aber kompliziertes Regierungssystem
Die Verfassungsurkunde der USA enthält an keiner Stelle das Wort ”demokratisch”, eine Unterlassung, die nicht zuletzt aus der von der Gegenwart verschiedenen Terminologie des ausgehenden 18. Jahrhunderts zu verstehen ist. Zur Zeit der Schaffung der Verfassung der USA verstand man unter dem Wort ”demokratisch” lediglich eine unmittelbare Demokratie, wie sie in antiken Stadtstaaten bestanden hatte und in einzelnen Schweizer Kantonen existierte. Eine auf dem Repräsentativsystem aufgebaute, das Prinzip der Volkssouveränität zum Mindesten theoretisch respektierende Verfassungsform nannte man ”Republik”. Nur unter Berücksichtigung dieses Sprachgebrauchs ist es voll verständlich, warum bei der Beratung und Ratifizierung der Verfassung mit solchem Nachdruck darauf hingewiesen wurde, daß die USA zwar ein republikanisches, aber kein demokratisches Staatswesen darstellen sollten. […]
Schutz der Minderheiten
Die amerikanische Verfassung ist das Werk von Männern mit einer umfassenden historischen und philosophischen Bildung. Der in Deutschland nur wenig bekannte ”Federalist” gehört zu den klassischen Werken der Weltliteratur der Politik. Unter der Alleinherrschaft eines von einer demokratischen Mehrheit gewählten Parlaments und einer von einem demokratischen Parlament abhängigen Regierung hielten die Väter der Verfassung die Rechte der Minderheiten für ständig bedroht und daher nicht nur die religiösen Freiheitsrechte der religiösen Sekten, sondern auch die Eigentumsrechte der (eine dünne Oberschicht bildenden) ökonomischen Elite für gefährdet.
Nicht die Herrschaft der Mehrheit, sondern der Schutz der Minderheiten war das primäre Anliegen der ursprünglichen Verfassung der USA. Der Rousseau’sche Gedanke eines a priori gültigen Gemeinwohls ist ihr ebenso fern wie die Vorstellung, daß die Herrschaft des Gemeinwillens die Unterdrückung der Privatinteressen erforderlich mache. Die Verfassung von 1787 geht vielmehr von der Annahme aus, daß dem Gemeinwohl dann am besten gedient sei, wenn allen Sonderinteressen der gleiche Schutz und die gleiche Chance gewährt und gleichzeitig ausreichend Vorsorge getroffen werde, daß kein Einzelinteresse einen dominierenden Einfluß auszuüben in der Lage sei. Die Ablehnung der ”direkten” Demokratie und die Bejahung der repräsentativen ”Republik” wird mit der Erwägung gerechtfertigt, daß mittels einer Repräsentativverfassung nicht nur der Schutz, sondern auch der Ausdruck der Minderheitsinteressen ermöglicht werde.
Nach der Konzeption der amerikanischen Verfassung kann das Gemeinwohl nur durch das freie Zusammenspiel der Einzelinteressen erreicht werden. Hierzu sind Spielregeln erforderlich, die - zum Mindesten in der ersten Periode der amerikanischen Verfassungsgeschichte - sehr viel stärker durch rechtsstaatliche und pluralistische als durch demokratische Gedankengänge bestimmt waren.
Das demokratische Element im Prozeß der politischen Willensbildung der USA wird durch die Tatsache gekennzeichnet, daß im Gegensatz zu Kontinentaleuropa
1) die demokratischen Kräfte sich nicht gegen monarchische, aristokratische, bürokratische und militärische Kräfte durchzusetzen, sondern ausschließlich mit der Opposition einer sich in ihren Eigentumsrechten bedroht fühlenden wirtschaftlichen Elite zu rechnen hatten;
2) der endgültige Sieg der demokratischen Kräfte nicht durch theoretisch abgeleitete Vorstellungen eines ”Gesamtwillens” beeinflußt war, der die Geltendmachung von Partikularinteressen ausschließt, sondern als eine Erscheinungsform der Wahrnehmung der individuellen Interessen der sozial nicht differenzierten Siedler des neuerschlossenen Grenzraums (”frontier”) in Erscheinung trat.
Die schrittweise Demokratisierung des amerikanischen Regierungssystems hat dessen rechtsstaatlichen und pluralistischen Charakter nicht beeinträchtigt. Ebensowenig wie die Doktrinen Rousseaus den ursprünglichen Verfassungstext, haben die Theorien der Französischen Revolution die Fortentwicklung der Verfassungsordnung maßgeblich bestimmt.
Pluralistische Demokratie
Letzten Endes hängt die Bedeutung, die den im amerikanischen Regierungsprozeß in Erscheinung tretenden Faktoren zuerkannt wird, von den Grundvorstellungen über Wesen und Ziel der Demokratie ab, in deren prinzipieller Bejahung sich alle einig sind. Nur daß sich hinter dem Bekenntnis zur Demokratie grundverschiedene politische Haltungen zu verbergen vermögen: Eine plebiszitäre Vorstellung der Demokratie, die von der These ausgeht, daß jede staatliche Hoheitstätigkeit eine Emanation (Ausfluß) eines einheitlichen nationalen ”Gemeinwillens” darstellen und von ihm getragen werden solle, und eine pluralistische Vorstellung der Demokratie, die von der Vorstellung ausgeht, daß jede staatliche Hoheitstätigkeit die Resultate aus dem Kräftespiel der verschiedenen Gruppenwillen darstellen und von diesen gebilligt werden solle.
Seit den Tagen, in denen die ”Federalist Papers” verfaßt wurden, haben in den USA diese beiden Anschauungen der Demokratie miteinander um die Vorherrschaft gerungen. Zuweilen hat dieses Ringen zu einer Art Arbeitsteilung geführt und bewirkt, daß die Ideologie der Demokratie auf der plebiszitären und die Soziologie der Demokratie auf der pluralistischen Grundvorstellung vom Wesen der Demokratie aufgebaut war.
Gemeinwohl und Gruppeninteressen
Es wäre allzu einfach, den Drang und den Glauben nach einem einheitlichen ”Gemeinwillen” lediglich als ”falsches Bewußtsein” abzutun; und es wäre allzu bequem, die Existenz und die Betätigung der Gruppenwillen lediglich als soziale Verfallserscheinungen abzulehnen. Besteht doch die Gefahr, daß ohne den Glauben an das Vorhandensein eines Gemeinwillens das Gemeinwohl gefährdet, wenn nicht gar beeinträchtigt wird, weil sich sonst herausstellen mag, daß ein Gruppenkompromiß entweder unmöglich oder lediglich unter einseitiger Berücksichtigung der Interessen der stärksten dieser Gruppen zu erreichen ist. Wie denn andererseits die Gefahr besteht, daß ohne die Gewährung eines freien Betätigungsrechts die Minoritätsgruppen sich vernachlässigt, wenn nicht gar vergewaltigt fühlten, und der amerikanischen Nation niemals hätten eingegliedert werden können bzw. ihr wieder entfremdet worden wären. […]
Bis in die Gegenwart hinein leben die Vereinigten Staaten von Amerika nach dem Gesetz, nach dem sie angetreten sind: der Bereitschaft, den Mitgliedern der verschiedenen Gruppen, aus denen die heterogene amerikanische Nation zusammengesetzt ist, eine freie Entfaltungsmöglichkeit und den Gruppen selber ein freies Betätigungsrecht zu gewähren.
Das naturrechtlich legitimierte amerikanische Verfassungsrecht garantiert nicht nur die Existenz dieser Gruppen, sondern legt auch die Spielregeln fest, nach denen sie im Gesamtgefüge der nationalen Einheit zu operieren berufen sind und normiert zugleich die Beschränkungen, die einer jeden dieser Gruppen und der Gesamtheit auferlegt sind. Beides ist zur Pflege des Gemeinwohls einer Nation unerläßlich, die sich gerade deshalb als politische Einheit fühlt, weil die autonome Entwicklung der Partikulargruppen gewährleistet ist, aus der sie sich zusammensetzt. Der stärkste Integrationsfaktor der Vereinigten Staaten von Amerika ist die Anerkennung des pluralistischen Charakters der amerikanischen Nation. […]
Ernst Fraenkel, Das amerikanische Regierungssystem, Westdeutscher Verlag, Köln/Opladen 1960, S. 39 ff. und S. 343 ff.
Mächtige Ausschußvorsitzende
Das Gewicht der Ausschüsse im Entscheidungsgefüge des Kongresses verbürgt ihren Vorsitzenden Einfluß und Prestige. Gemeinsam mit den Führungsspitzen der jeweiligen Mehrheits- und Minderheitsparteien in beiden Kammern und dem Sprecher des Repräsentantenhauses bestimmen sie die parlamentarischen Entscheidungsprozesse. Sie üben eine weitgehende Kontrolle über die Einberufung, Tagesordnung und Zeitplanung ihres Ausschusses aus, können also in begrenztem Rahmen den Gang eines Gesetzesentwurfs durch die Kongreßmaschinerie verlangsamen, blockieren oder beschleunigen.
Überdies bestimmen sie über die Stärke des Mitarbeiterstabes und beeinflussen auch deren Auswahl. Bis zur Mitte der siebziger Jahre verfügten die Führungszirkel in der Fraktion über die Verteilung der Ausschußsitze. Die Ausschußvorsitzenden wurden nach dem sogenannten Anciennitätsprinzip bestellt, nach ihrem "Dienstalter" sozusagen. Ämterh